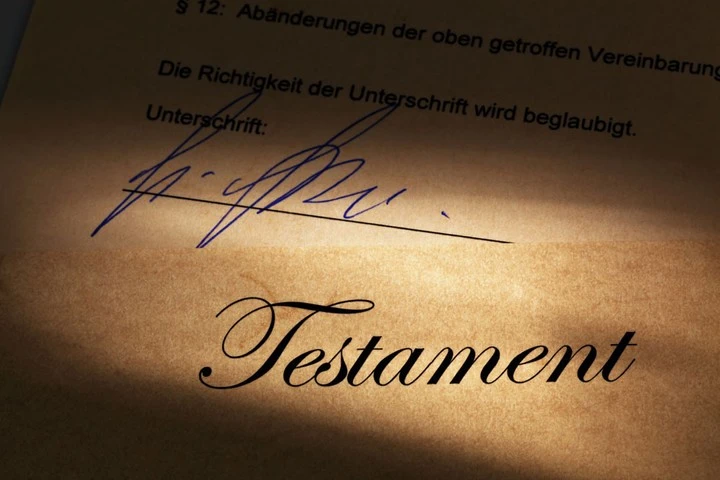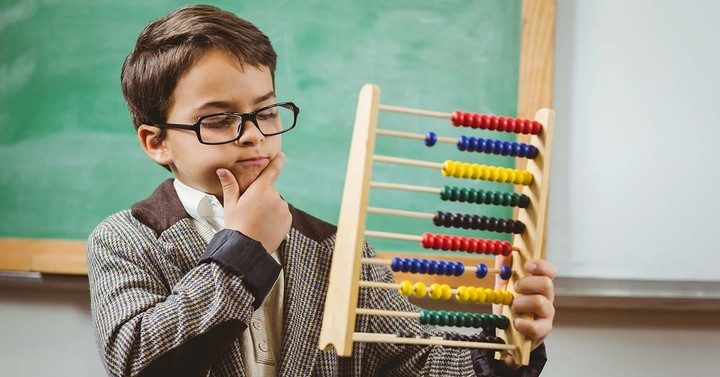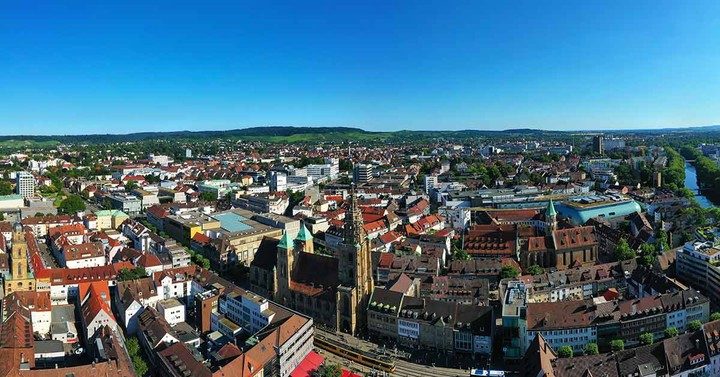In Deutschland wird der weitaus größte Teil an Erbbaurechten von Kommunen und Kirchen vergeben. In diesen Fällen sind Verlängerungen des Erbbaurechtsvertrages eher die Regel als die Ausnahme – auch weil kaum Interesse daran besteht, die Grundstücke und die darauf befindlichen Immobilien selbst zu nutzen. Bei privaten Erbbaurechten kann das hingegen anders aussehen. Grundsätzlich sind drei Optionen denkbar:
Der Vertrag läuft aus und der Erbbaurechtgeber möchte diesen nicht verlängern
Läuft der Erbbaurechtsvertrag nach der vereinbarten Laufzeit aus, verliert der Pächter sein Nutzungsrecht und die Immobilie fällt automatisch an den Erbbaurechtgeber zurück. Er muss diese jedoch ablösen – und zwar zu mindestens zwei Dritteln ihres Verkehrswertes.
Der Erbbaurechtgeber bietet bei Vertragsende eine Verlängerung an
Bietet der Erbbaurechtgeber eine Verlängerung des abgelaufenen Vertrages an, so kann alles weiterlaufen wie bisher. Aber: Die Fortführung des Vertrages räumt dem Grundstückseigentümer das Recht ein, den Erbbauzins erheblich zu erhöhen, und zwar bis auf das Achtfache des vorherigen Wertes.
Der Erbbaurechtgeber bietet eine Verlängerung an, die abgelehnt wird
Lehnt der Erbbaurechtnehmer die vom Grundstückseigentümer angebotene Vertragsverlängerung ab, dann fällt die Immobilie entschädigungslos an ihn zurück. Insofern ist eine solche Ablehnung natürlich in keinem Fall ratsam. Es kann jedoch sein, dass der neue, deutlich höhere Erbbauzins die finanziellen Möglichkeiten des Erbbaurechtnehmers sprengt.
Wichtig:
Beim Kauf einer Immobilie auf Erbbaurechtsbasis übernehmen Immobilienkäufer nur die Restlaufzeit des existenten Vertrages, sie starten also nicht neu von vorn. Es empfiehlt sich daher, sehr sorgfältig zu prüfen, wie lange der Vertrag noch läuft und ob die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung als hoch einzustufen ist. Grundsätzlich ist ein Wiederverkauf einer Erbbaurechts-Immobilie mit Schwierigkeiten und oftmals einem niedrigeren Preis verbunden.